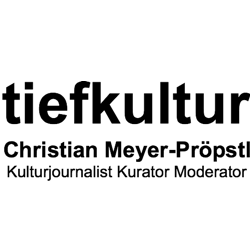Martin will nach seinem psychischen Zusammenbruch voller Hoffnung zu seinem alten Leben zurückkehren. Doch der Job ist weg, die Freundin auch und mit ihr die Wohnung. Es folgen Alkoholsucht und schließlich Obdachlosigkeit. Erst als er einen 10jährigen Russen auf der Straße trifft, hat er neue Hoffnung. Mit ihm baut er eine Hütte im Wald und beginnt, seine eigene Welt zu genießen. Doch die Gesellschaft holt ihn wieder ein. Mit seinem neuen Film scheint Weingartner zu seinem Debüt „Das weiße Rauschen“ zurückzukehren – thematisch wie ästhetisch. Zwar hat das Politische und Soziale seiner letzten Filme auch hier Platz, aber nicht deren didaktischer Gestus. Die Hauptdarsteller vermitteln den sozialen und psychischen Abstieg beeindruckend, der Plot-Point wirkt der Einfühlung allerdings nachträglich entgegen.
INTERVIEW MIT HANS WEINGARTNER:
Herr Weingartner, nach „Free Rainer“ überrascht ihr neuer Film: Der actionreiche Agit-Prop des Vorgängers weicht einem ruhigen, psychologischeren Ansatz. Was hat diesen Stilwechsel bewirkt?
Hans Weingartner: Erstens mag ich die Abwechslung, und zweitens gab es bei „Free Rainer“ von allem ein bisschen zu viel: zu viel Drama, zu viel Handlung, zu viel Charaktere, zu viele Inhalte. Dieser Irrsinn war zwar Teil des Konzepts, aber trotzdem: Ich wollte back to the roots, zurück zum schlanken Filmemachen, zur Essenz. Was brauche ich wirklich, um eine Geschichte zu erzählen? Zwei Hauptfiguren, die Straße, den Wald, eine Kamera.
Thematisch nähern sie sich mit dem psychischen Zusammenbruch ihrer Hauptfigur ihrem Debüt „Das weiße Rauschen“, ohne jedoch die großen politischen und sozialen Themen der letzten Jahre zu vernachlässigen. Inwiefern würden Sie sagen, dass die psychologischen und die sozialen bzw. politischen Themen des neuen Films zusammengehören?
Das eine bedingt das andere – so ist es doch auch in der Realität. Ob dieses Wirtschaftssystem und damit diese Gesellschaft funktioniert, hängt beispielsweise auch von der psychischen Belastbarkeit des Einzelnen ab. Wie man an der explosiven Zunahme von Depressionen, Burn-Outs und Angststörungen sehen kann, ist die Grenze da schon bald überschritten. Im Film geht es letztlich um eine Selbstbefreiung: Ich brauche den ganzen Scheiß nicht mehr, ich steig aus und geh in den Wald! Natürlich ist das symbolisch gemeint: Es soll eine Aufforderung sein, sein inneres Wesen wieder zu finden. Was macht mich als Mensch aus? Ist es das ganze Zeug, das um mich herum steht? Ist es die Frage, wie schön, wie schnell oder wie toll ich bin? Außerdem geht es um die Frage: Wenn ich wirklich mal durchticke, wie komme ich da wieder raus? Geht das nur mit Psychiatrie und Tabletten, oder gibt es Alternativen? Martin nimmt den Kampf auf gegen den Wahn und gewinnt ihn. Der Knackpunkt ist die Angst. Er besiegt seine Angst mit Hilfe des Kindes. Wer keine Angst hat, wird auch nicht psychotisch, und schon gar nicht depressiv, davon bin ich überzeugt.
Martins Schicksal erinnert unwillkürlich an die neue Welle von Aussteigern, an die Zeltstädte in den USA, aber auch an Filme wie „Into the Wild“ oder „Versaille“ mit Guillaume Depardieu. Was hat Sie zu dem Thema inspiriert?
Das ist immer die schwierigste Frage, weil so kreative Prozesse ja unbewusst ablaufen. Ich denke, dahinter steckt mein eigener Drang in die Wildnis. Wenn’s mir schlecht geht, geh ich den Wald oder in die Berge. Dort finde ich die Ruhe und nötige Distanz, um über mein Leben nachdenken zu können. Das kommt aus meiner Kindheit. Ich komme vom Dorf, und für uns Kinder war der Wald ein Ort der Freiheit. Dort komme ich zur Ruhe, und da lösen sich die Dämonen in Luft auf.
Es gibt diesen Plotpoint, der den Film aus einer sozialrealistischen Ebene zunächst in utopistische Sphären und dann in die Nähe eines Psychothrillers à la „Fight Club“ enthebt. Wie kamen Sie zu diesem dramaturgischen Kniff?
Ich kann einfach nicht anders. 120 Minuten Sozialrealismus, das halte ich nicht durch. Dafür bin ich ein viel zu unruhiger Geist. So rumänische Plattenbaufilme mit 10-Minuten-Totalen, das pack ich nicht, das kann ich einfach nicht. Ich bin ja in Wahrheit gar kein Autorenkunstfilmer. Meine Filme sind High-Concept-Geschichten mit einem Schmuddelanstrich. Ich habe eine große Leidenschaft zum Geschichtenerzählen, und die bricht halt irgendwann immer durch. Die lässt sich nicht bändigen. Ich muss jetzt unbedingt mal eine Komödie oder einen Thriller machen.
Arbeiten Sie denn bereits an einem neuen Projekt oder gibt es Pläne?
Ja, an einem Roadmovie im Stile von „Before Sunrise“. Zwei junge Menschen, die sich zwei Stunden lang über Gott und die Welt unterhalten und sich dabei ineinander verlieben. Leider habe ich große Probleme, die ideale Besetzung zu finden. Ansonsten warte ich, was da so kommt. Ich würde wahnsinnig gerne mal ein Drehbuch von jemand anderem verfilmen, oder für jemand anderen schreiben. Ich will kein Autorenfilmer mehr sein! Dieser Spagat zwischen „sensibler Autor“ und „Regie-Tier“, der ist fällig.
(Bundesstart: 2.2.2012)