Morgen muss Yvonne in den Knast. Mit ihren Freundinnen Katharina und Jenny streunt sie durch ihren trostlosen Vorort der Vorsilvesternacht, immer auf Konfrontation aus …
Mit seiner nüchternen Machart passt das Debüt von Birgit Grosskopf gut in die Berliner Schule: Der Vorort der Mädchengang und der Alltag dort wird weder künstlerisch dramatisiert, noch beschönigt: Hier ist einfach alles trostlos, geht die Gewalt nicht nur von den Mädchen aus, sondern auch von der die Menschen verwahrenden Architektur. Die latent aggressive Stimmung findet ein treffendes akustisches Pendant in den Explosionen der Knallkörper, die das Geschehen kurz vor Silvester begleiten. Grosskopf zeichnet ein festes soziales Gefüge, aus dem kaum ein Entrinnen möglich scheint. Auch oder gerade weil dessen innere Logik absurd erscheint und die Gewalt nie den trifft, der es erwartet. Innen ist keine Sicherheit und nach draußen kommt man sowieso nicht. Und so kämpft auch Katharina bei ihrem Versuch, auszubrechen, einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen alle und alles.
INTERVIEW MIT BIRGIT GROSSKOPF:
Du schilderst ein in dieser Form eher ungewöhnlich hartes Bild einer Mädchengang. Wie sah die Recherche zum Thema aus – gab es reale Figuren oder Orte als Vorbilder?
Mit meiner Co-Autorin bin ich sehr zeitintensiv an bestimmte Orte gegangen, um zu recherchieren – fast so, als würde ich einen Dokumentarfilm drehen. Die Grundidee hatte ich bereits im Kopf, was ich dann erlebt und beobachtet habe, ist mit in den Film eingeflossen. Ich finde das sehr interessant, dass viele die Story hart finden – ich finde sie nur authentisch. Ein Schlüsselerlebnis hatte ich, als ich in Berlin nach einer Drehbuchbesprechung für „Prinzessin“ in der S-Bahn saß und von fünf Mädchen exzessiv körperlich bedroht wurde.
Der Ort ist bewusst allgemein gehalten. Obwohl sie nur den Hintergrund für die Handlung abgibt, scheint die trostlose Architektur bestimmend für das Schicksal der Protagonistinnen zu sein. Wie wichtig war dieser Hintergrund für die Ästhetik des Films?
Schon früh war mir klar, dass es eine „anonyme“ Vorstadt sein soll. Leute, die behaupten, dass die Umgebung einen Menschen unbeeinflusst lässt, halte ich für naiv. Ich lasse mich immer sehr von den Orten leiten, wenn ich einen Film entwickle. Der Ort ist für mich Teil der Dramaturgie, eine weitere Figur, die einen starken Einfluss auf die anderen Figuren hat. Dazu kommt im Fall von „Prinzessin“, dass ich an einem der Drehorte meine Kindheit und Jugend erlebt habe. Da hatte ich sozusagen einen Heimvorteil.
Das Ende des Films ist sehr radikal. Warum diese Dramatik an Stelle einer abgeschwächteren, vielleicht aber repräsentativeren Variante?
Ich habe ja zuerst in Großbritannien studiert und gelebt – und bin von dort her sicherlich auch stark beeinflusst, was das „Storytelling“ angeht. Meine großen Vorbilder sind Scorsese oder eben auch Fassbinder. Die haben auch immer die großen Bögen bevorzugt. Ich glaube, dass eine Geschichte „repräsentativer“ wird, wenn sie genau das nicht versucht zu sein. Ein Paradox, aber alles andere erscheint mir nur verlogen: Ich bin ja keine Statistikerin – ich mache Filme, erzähle Geschichten. Ich finde das Ende von „Prinzessin“ nur konsequent.
Der Vergleich liegt auf der Hand: Mit „Prinzessinenbad“ lief gerade erfolgreich ein Dokumentarfilm mit ähnlichem Thema. Wo liegen bei dem Thema Deiner Meinung nach die Vorteile des Spielfilms gegenüber dem Dokumentarfilm?
Ich habe das Gefühl, die Fiktionalisierung irritiert paradoxerweise mehr, als wenn man die Kamera „real“ draufhält – zumindest in Deutschland. Dabei ist unsere Geschichte sehr authentisch recherchiert und erzählt. Nur bietet einem die Fiktion die Chance zur Überhöhung, Zuspitzung und zu einer erzählerischen Konsequenz – die Manche bei diesem Thema doch noch verstört. Auf den Titel war ich übrigens sehr stolz. Als der Film fertig war, also vor zwei Jahren, gab es den noch nirgendwo: Dann kam der spanische „Princesas“ und nun „Prinzessinenbad“. Eines scheint alle Filme zu einen: ein Spiel mit so etwas wie einem Frauenbild, das nicht mehr ganz aufrecht zu erhalten ist.
(Bundesstart: 4.10.2007)
Zuerst erschienen in choices 9/07

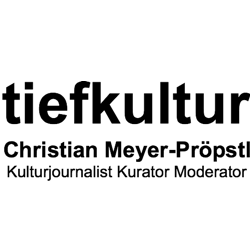


Eine Antwort auf „„Prinzessin“ von Birgit Grosskopf (Interview)“
Kommentare sind geschlossen.