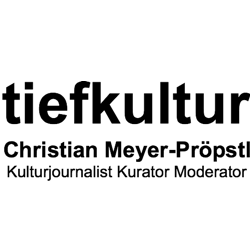„Die fetten Jahre sind vorbei“ oder „Sie haben zu viel Geld“ lauten die Botschaften, die die beiden linken Aktivisten Jan und Peter bei ihren nächtlichen Streifzügen durch Villen hinterlassen. Geklaut wird jedoch nichts, sie stellen nur die Einrichtung auf den Kopf. Als Jan bei einem Streifzug mit Peters Freundin Jule auf den Besitzer trifft, gerät ihre Aktion außer Kontrolle. Zu dritt entführen sie ihn…
Hans Weingartners vielbeachteter und zahlreich ausgezeichneter Spielfilm „Das weiße Rauschen“ mit Daniel Brühl in der Hauptrolle des schizophrenen Lukas war ein großer Überraschungserfolg. Danach musste man fürchten – vor allem, da es sich um ein Erstlingswerk handelte – dass die Erwartungen und Ansprüche die Produktion des zweiten Films ersticken könnten. Als Weingartner dann im Frühling seinen Film „Die fetten Jahre sind vorbei“ in Cannes als ersten deutschsprachigen Beitrag seit 11 Jahren zeigen konnte, spülten bereits die ersten Reaktionen aus aller Welt die Zweifel beiseite. Ein Befreiungsschlag!
Um Befreiungsschläge geht es auch im Film selbst: Jan und Peter gefallen sich in der Rolle als symbolisch handelnde Spaß-Guerilla, die sich „Die Erziehungsberechtigten“ nennt, ganz gut. Sie sind was Besseres als die, die nur rumdiskutieren. Mit ihren nächtlichen Aktionen wollen sie für Verunsicherung sorgen, den Reichen nicht ihre Reichtümer, sondern etwas viel Bedeutenderes rauben: das Gefühl der Sicherheit. Doch Jan hat größere Ideen im Kopf. Während Peter bei den nächtlichen Streifzügen auch gerne mal ein kleines Schmuckstück einstecken würde, träumt Jan davon, statt nur die Möbel in fremden Häusern die sozialen Verhältnisse zu verrücken. Zusammen mit Jule, in die er sich in Peters Abwesenheit verliebt, betrachtet er die Welt als Matrix und kommt zum selben Schluss wie Tom Cruise: „Du siehst sie und kannst nicht in ihr leben“. Tatsächlich bleibt aber alles beim Alten, und es ist nur ein Missgeschick, keine geplante Aktion, die alle drei dazu bringt, den nächsten Schritt, von der hauptsächlich symbolischen Handlung innerhalb der Gesellschaft zum irreversiblen Austritt aus dieser Gesellschaft zu vollziehen.
Weingartner inszeniert den ersten Teil seines Films betont aktionsgeladen und führt den Zuschauer in eine Atmosphäre jugendlichen Stürmens und Drängens – einem Leben zwischen Liebe, Politik, Pop und Utopie, in dem es aber natürlich auch Alltagsprobleme zu bewältigen gibt. Und plötzlich ein ganz Großes: was machen mit dem Besitzer der Villa, dem Besitzenden, der sie bei einem ihrer „Brüche“ überrascht? Hardenberg wird panisch ins Auto verladen und kurzer Hand verschleppt
Den zweiten Teil des Filmes siedelt Weingartner kontrastreich in einer Almhütte in den Alpen an. Wo der erste Teil Kraft und Naivität gleichermaßen ausstrahlt, folgen nun Momente des Innehaltens und Nachdenkens. Es entspannt sich eine regelrechte Diskussionskultur zwischen dem Entführungsopfer, dem reichen „Bonzen“, und seinen drei Bewachern. Die Bälle werden einander zugeworfen: „Wir leben in einer Demokratie!“ „Nein, wir leben in einer Diktatur des Kapitals!“ (das weiß übrigens Weingartner selbst sehr genau und lässt den Kinostart von der Veröffentlichung einer Doppel-CD und des ‚Romans zum Film’ begleiten). Hardenberg lenkt ein, damals, als er jung gewesen sei, ähnlich gedacht zu haben. Hardenberg wird menschlich. Hardenberg kifft mit seinen Entführern. Und Hardenberg mischt sich freundschaftlich in das Liebesleid der drei ein. Denn hier auf der Alm wird nicht nur theoretisiert, wird nicht nur das einst objektive Feindbild zum Menschen in nächster Nähe, hier zeigt sich auch, dass die politisch Bewegten selber Subjekte sind, die nicht aus einer sicheren, objektiven Perspektive heraus handeln können und zu allem Überfluss auch noch persönliche Probleme untereinander aushandeln müssen. Die Illusionen des klaren Feindbildes und des klaren Zieles geraten zunehmend ins Wanken.
Weingartner ist mutig genug, die Plausibilität der revolutionären Kraft, die man im ersten Teil erfährt, scharf zu hinterfragen. Aber nur um sie danach mit einem Befreiungsschlag noch vehementer behaupten, ja feiern zu können. Dabei kann er sich auf großartige Schauspieler verlassen: während Burghart Klaussner als Hardenberg aalglatt zwischen Manager und verständnisvoller Vaterfigur wandelt, transportieren Daniel Brühl, Stipe Erceg und Julia Jentsch (demnächst mit ebenfalls großartiger Darbietung in Hans W. Geissendörfers „Schneeland“ im Kino zu sehen) diese unvergleichliche Mischung aus Selbstbewusstsein, Verunsicherung und wütendem Trotz der Jugend.
INTERVIEW MIT HANS WEINGARTNER
Woran nährte sich der Antrieb, einen derart expliziten und radikalen politischen Film in einer eher unpolitischen Filmlandschaft wie Deutschland zu machen?
Mich hat das subversive Element, das in jedem Menschen steckt, immer schon interessiert. Sind wir doch ehrlich: keiner macht gern sein Leben lang, was ihm vorgeschrieben wird. Die Kombination Jugend und Revolte zieht sich durch die Menschheitsgeschichte.
Welche Überlegungen – ästhetisch, dramaturgisch, vielleicht sogar didaktisch – stehen hinter der relativ klaren Trennung von Aktionismus im ersten Teil und dialektischer Theoretisierung vor entrückter Almkulisse im zweiten Teil?
Der „Theorieblock“ in der Almhütte sollte zeigen, dass die Aktivisten ein theoretisches Fundament haben. Die Enge der Hütte intensiviert den Zusammenprall der Charaktere, die Berglandschaft öffnet dann ihre Herzen und weitet den Blick. Hektik in der Großstadt, Ruhe und Philosophieren in der Natur – ein dankbares visuelles Thema.
Warum wird dem Thema Liebe eine solch große Rolle in dem Film eingeräumt. Neben der Erkenntnis, dass politisches Handeln nicht im luftleeren Raum geschieht, sondern von Individuen mit persönlichen Geschichten und Konflikten gemacht wird, ist dies vielleicht auch ein Tribut an die Gesetze des Marktes: eine Liebe muss im Film vorkommen?
Nein nein, mit der Liebesgeschichte fing alles an. Das war der Kern der Geschichte, immer schon. Ich hatte noch nie einen Film über die Liebe gemacht und wollte das mal ausprobieren. Ein Film über die Jugend ohne Liebe und ohne Musik geht außerdem gar nicht. Denn darum dreht sich alles in dem Alter.
Wie hat sich die Entscheidung gegen ein realistisches und für ein utopisches Ende vollzogen? Woher kommt der Optimismus, über den ich tatsächlich sehr glücklich war?
Das war eine bewusste Entscheidung gegen das übliche, nüchterne sozialdramatische Ende und soll das Gefühl unterstützen, mit dem man aus dem Kino kommt: energiegeladen und aktionsbereit. Der Optimismus nährte sich aus eigenen Lebenserfahrungen in meiner Hausbesetzerzeit, die mit die Schönste meines Lebens war. Wir waren mehr Hippies als Hausbesetzer.
(Bundesstart: 25.11.2004)
Zuerst erschienen in choices 11/04